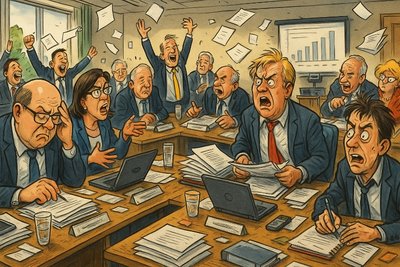Wenn Lokalpolitik zum Varieté wird – Dortmunds Wirtschaftsausschuss tagt
Doch in Dortmund weiß man: Hier wird nicht nur getagt – hier wird Geschichte geschrieben. Oder zumindest so getan. Willkommen bei der großen Show der Tagesordnungspunkte!
Erster Akt: Ritual der Bürokraten
Wie bei jeder guten Inszenierung beginnt alles mit den Klassikern:
- Mitwirkungsverbote – das ist wie die Eröffnungsszene eines Krimis. „Darf der Verdächtige hier eigentlich mitspielen?“
- Tagesordnung genehmigen – einmal Hand hoch, einmal nicken, fertig. Der eigentliche Höhepunkt besteht darin, dass niemand die Tagesordnung wirklich gelesen hat.
- Niederschriften genehmigen – die Minuten des Mai und Juni werden feierlich abgesegnet, als hätte man gerade den Westfälischen Frieden unterzeichnet.
Zweiter Akt: Die Wirtschaft tanzt Walzer
Dann wird’s ernst: Aktuelle Angelegenheiten der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. Klingt trocken, ist aber der eigentliche Programmpunkt, an dem alle mit ernsten Mienen PowerPoint-Folien anschauen, die so grau sind wie das Wetter in Eving.
- Halbjahresbericht Arbeitsmarkt: Ein Zahlenfeuerwerk, das mehr Excel als Hoffnung versprüht. Menschen reden von „positiven Tendenzen“, meinen aber: „Es könnte schlimmer sein.“
- Projektförderungen: Hier entscheidet man, wem die Stadt Geld zusteckt. Ein bisschen wie „Wetten, dass..?“, nur ohne Wetten und ohne dass.
- Ernährungswirtschaft: Ein ungenutzter Programmpunkt für Wortspiele wie „Dortmund beißt an!“ oder „Die Zukunft ist Bio – außer im Stadion, da bleibt’s Currywurst.“
Und dann das große Finale: Jahresabschluss des Technologiezentrums. Wer dachte, Hightech bedeutet Roboter, Laser oder Raketen, liegt falsch. Hier heißt es: Tabellen, Prüfberichte und ein Vortrag über die glorreiche Kunst, Defizite schönzurechnen.
Dritter Akt: Investitionen – oder die Kunst des Jonglierens
Jetzt schlägt die Stunde der Kostenschätzungen:
- Logistik & IT: Hier wird versprochen, Dortmund zum digitalen Knotenpunkt Europas zu machen. Tatsächlich bedeutet es: schnelleres WLAN im Rathaus – vielleicht, irgendwann, falls die Firewall mitspielt.
- Integrierte Wirkstoffforschung: Klingt wie ein Marvel-Film, ist aber nur der Versuch, Laborgebäude mit Finanzmitteln zu füttern.
Die Diskussionen drehen sich wie eine Waschmaschine: vorne Kosten rein, hinten Rechtfertigungen raus.
Vierter Akt: Quartiers-Karaoke
Plötzlich geht’s ins Lokale: Quartierskoordination Eving und Marten. Zwei Stadtteile, die nun offiziell „koordiniert“ werden. Was das heißt? Wahrscheinlich neue Arbeitskreise, bunte Flyer und ein Bericht mit dem Titel „Wir haben geredet“.
In Marten heißt es: Zukunftskonzept! Übersetzt bedeutet das: Ein PDF-Dokument mit 150 Seiten, das im Bezirksamt in einem Schrank verstaubt, bis es beim nächsten Straßenfest als Unterlage für den Grill dient.
Fünfter Akt: Digitalträume und Kassenpoesie
Jetzt kommt die große Zukunftsvision: „Digital, sicher, nachvollziehbar – moderne Kassen- und Rechnungssysteme“. Klingt nach Innovation, ist aber wahrscheinlich ein neues Kassensystem, das Bonrollen mit Bluetooth verbindet.
Dazu der Nachtrag: „Hilfreiche Verwaltung als Standortfaktor“. Eine Formulierung, die so vage ist, dass sie in jedes Wahlprogramm von den Linken bis zur FDP passt. Vermutlich bedeutet es: „Unsere Schalter öffnen jetzt auch mittwochs bis 12:15 Uhr.“
Hinter den Kulissen: Der nichtöffentliche Teil
Und dann, wenn das Publikum längst eingeschlafen ist, schließt sich der Vorhang. Nicht-öffentlich tagt der Ausschuss weiter: Grundstücksgeschäfte, geheime Finanztricksereien, Förderungen, die klingen wie Start-up-Namen, und Altlasten aus der Kanalstraße.
Die Bürger dürfen draußen bleiben, aber keine Sorge: Es geht ohnehin nur um Millionenbeträge, Bauflächen und Dinge, die „aus Gründen der Vertraulichkeit“ nie in die Zeitung kommen.
Requisiten der Sitzung
Natürlich dürfen die Accessoires nicht fehlen:
- Mineralwasser in Flaschen, das seit drei Sitzungen offen ist.
- Keksteller, schon halb leer, bevor die Sitzung beginnt.
- Laptops, die aufklappen, um PDFs anzuzeigen, die nie jemand liest.
- PowerPoint-Beamer, der regelmäßig abstürzt und dann fünf Minuten lang „bitte warten“ an die Wand projiziert.
Publikum und Statisten
Im Zuschauerraum sitzen drei Bürger, die zufällig hereingestolpert sind, weil sie dachten, es gäbe Kaffee. Zwei Journalisten starren auf ihre Handys, während der Praktikant der Verwaltung verzweifelt versucht, mitzuschreiben, ohne einzuschlafen.
Der dramaturgische Höhepunkt: Das Fazit
Am Ende bleibt das Gefühl: Hier wird nichts entschieden, was nicht sowieso schon längst beschlossen war. Aber das Ganze bekommt durch den feierlichen Rahmen die nötige Schwere – wie ein Theaterstück, das man jedes Jahr neu aufführt.
- Die Wirtschaft bleibt stark – zumindest auf PowerPoint.
- Die Beschäftigungsförderung bleibt beschäftigt mit sich selbst.
- Die Quartiere werden koordiniert, aber niemand weiß, wohin.
- Und die Kassen werden digitalisiert, damit das Bargeld wenigstens auf dem Bildschirm alt aussieht.
Die Sitzung zeigt, wie Demokratie funktioniert – oder zumindest, wie sie in Dortmund aufgeführt wird: Viele Worte, wenige Überraschungen, dafür jede Menge Selbstinszenierung. Es ist, als würde man ein Fußballspiel anschauen, bei dem beide Mannschaften schon vor Anpfiff auf ein Unentschieden geeinigt sind.
Die Zuschauer gehen nach Hause mit dem beruhigenden Gefühl: Es tagt, also existiert es. Und die Stadt bleibt in Bewegung – zumindest auf dem Papier.